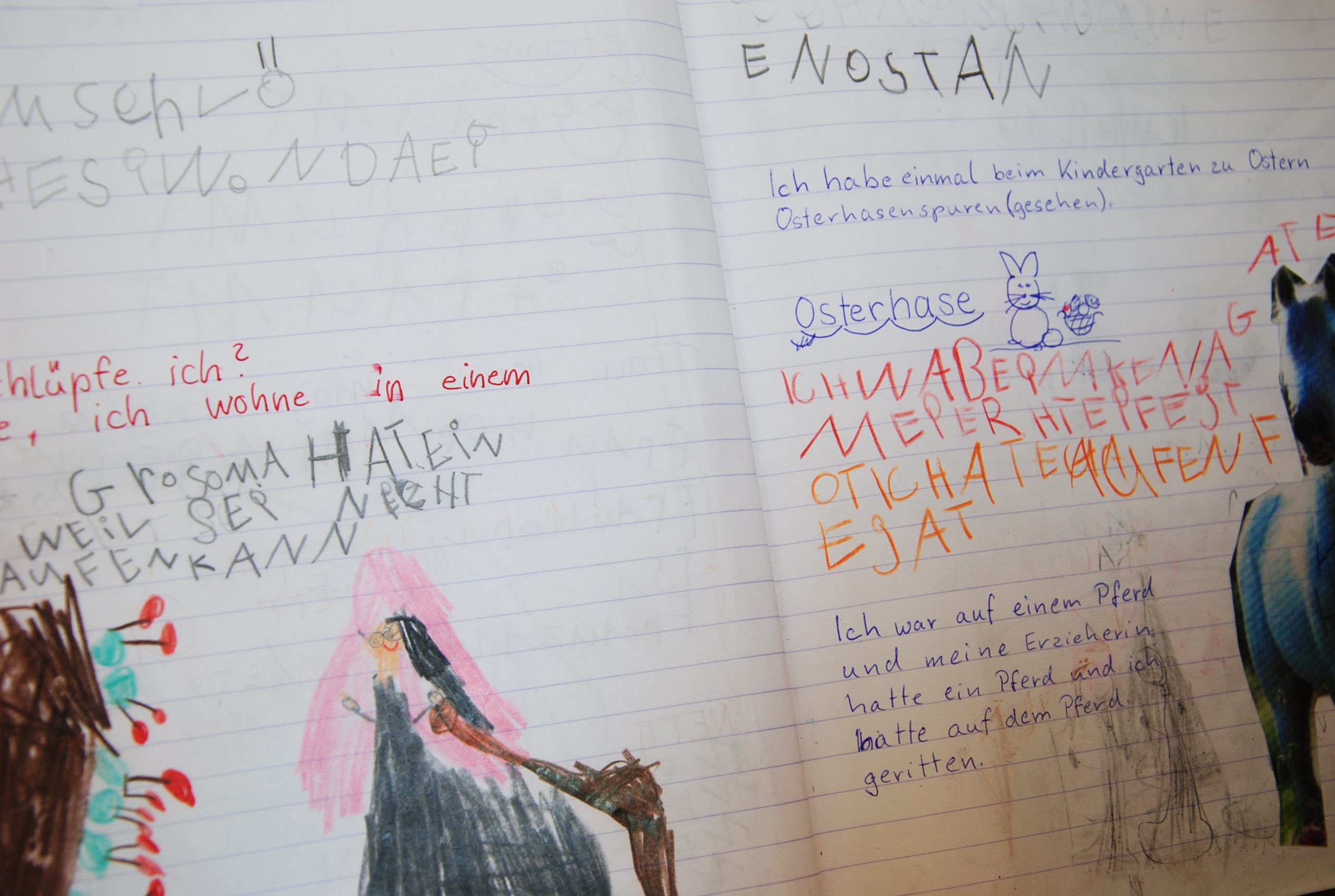Der systematische Ausbau von Ganztagsschulen stellt die beteiligten Lehrkräfte und Schulleitungen vor neue Herausforderungen. So sehen sich Lehrkräfte an Ganztagsschulen gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen an Halbtagsschulen spezifischen Kooperationsanforderungen ausgesetzt.
Von Karsten Speck
Empirische Befunde zur Kooperation des Personals an Ganztagsschulen
Aktuelle Ergebnisse der zweiten Befragungswelle der bundesweiten „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) belegen auf der einen Seite, dass sich zwischen 2005 und 2007 die Anzahl der Ganztagsschulen, die mit außerschulischen Partnern zusammenarbeitet und die Anzahl der Partner pro Schule erhöht haben. Zudem sind die Kooperationspartner mit der Zusammenarbeit weiterhin sehr zufrieden. Auf der anderen Seite besteht an den Ganztagsschulen offensichtlich nach wie vor ein erheblicher Entwicklungsbedarf bei der Verknüpfung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten. Insgesamt deuten die Befunde von StEG darauf hin, dass an Ganztagsschulen zwar eine Kooperation unterschiedlicher Berufskulturen stattfindet; diese jedoch offensichtlich häufig nur am Rande den Unterricht und die Schulorganisation berührt.
Fasst man die empirischen Daten von StEG zusammen, dann muss als eine zentrale Gelingensbedingung für die pädagogische Arbeit der Ganztagsschulen – die gelingende Zusammenarbeit des sehr heterogenen Personals mit unterschiedlichen Anstellungsträgern (z. B. Jugendhilfe, andere Träger), Beschäftigungsformen (hauptamtlich, nebenberuflich, ehrenamtlich), Stundenumfängen (ganze Stelle, halbe Stelle, stundenweise) und Qualifikationen (pädagogische vs. nicht pädagogische Qualifikation, Studium vs. Nicht-Studium; Ausbildung vs. Nichtausbildung) gewertet werden. Hier geht es zentral um Fragen der pädagogischen Eignung und der Professionalisierung der Personals: Die Kooperation von Ganztagsschulen mit ihren Partnern wird nur dann einen größeren pädagogischen Ertrag erbringen, wenn es Ganztagsschulen gelingt,
- zusätzliches, kompetentes Personal zu gewinnen und zu halten (Fachkräfte, Eltern, Ehrenamtliche),
- eine Koordinierung des Ganztagsbereiches abzusichern (Schulleitungsverantwortung),
- die Kooperationspartner als qualitativ hochwertige Bereicherung für den Ganztagsbereich anzuerkennen, unabhängig von ihren Beschäftigungsformen, Stundenumfängen und Qualifikationen sowie
- die Kooperationspartner konzeptionell und gremienbezogen in die Ganztagsschulen einzubinden. […]
Befunde der wissenschaftlichen Begleitung der Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz (vgl. Krieger 2005) weisen auf unterschiedliche Bildungsverständnisse, Bildungsideale und lernmethodische Prinzipien bei den Ganztagsschulen und ihren Kooperationspartnern sowie anfänglich fehlende Kommunikationsstrukturen zwischen den Beteiligten hin. Die Befunde lassen die Annahme zu, dass eine Kooperation des Personals an Ganztagsschulen nicht als selbstläufig angesehen werden kann, sondern abgesprochen, gepflegt und strukturell abgesichert werden muss. Zum anderen deuten die Befunde der wissenschaftlichen Begleitung darauf hin, dass die außerschulischen Kooperationspartner durch die Einbindung in die Ganztagsschule strukturell denjenigen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, deren ungelöste Bewältigung – zumindest in der Jugendhilfedebatte – nicht selten den Lehrern vorgeworfen wird (z. B. Schwierigkeiten im Umgang mit disziplinschwierigen Schülern, mangelnde Motivation der Schüler, Dilemma der Wahlfreiheit vs. der Absicherung von Angeboten). Dies bedeutet für die pädagogische Eignung, dass Kooperationspartnern bewusst sein muss, dass sie z. T. erhebliche Anpassungsleistungen an das schulische System und Schülerverhaltensweisen erbringen müssen und andererseits, dass Schulen bewusst sein muss, dass ihre Kooperationspartner über eine andere institutionelle Einbettung und berufliche Logik verfügen und sie sich hierauf einstellen müssen. […]
Schlussfolgerungen für die pädagogische Eignung des Personals an Ganztagsschulen
24.01.2012